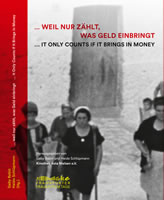
Remake. Frankfurter Frauen Film Tage wird von der Kinothek Asta Nielsen e.V. veranstaltet und findet vom 23.-28.11.2021 zum dritten Mal statt. „, …weil nur zählt, was Geld einbringt‘ – Frauen, Arbeit und Film“ ist das Schwerpunktthema der dritten Festivalausgabe. Die Würdigung der Geschichte von Frauenfilmfestivals wird bei Remake 3 mit einem Rückblick auf die Feminale (Köln) und femme totale (Dortmund) fortgesetzt. Die Personale „Ungenierte Unterhaltung – Frieda Grafe. Filmkritikerin“ erinnert an die bedeutende Autorin der bundesdeutschen Kino- und internationalen Filmgeschichte. Remake verschreibt sich der Wiederentdeckung und Neuaufführung von Filmen aus der Geschichte im Kontext aktueller Filme. Ausgehend von Themenschwerpunkten entfaltet sich Remake in einer Mischung aus Festival und Symposium. Unterschiedliche Epochen und Genres verflechten sich im Programm. Im Fokus: Frauen, Geschlechterverhältnisse, Emanzipation, Aspekte des queer cinema und ein anderer Blick auf die Gesellschaft, auf Phänomene wie Migration, Kolonialismus, Rassismus. Restaurierungen und eine Begleitpublikation dienen der Nachhaltigkeit von Remake. Frankfurter Frauen Film Tage. Siehe Programm und weitere Informationen, auch eine Publikation zu den Film-Tagen 2021
weiterlesen »