[Buch] „Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft“ – und wie Debatten um Eigenverantwortung auch »ganz unten« wirken
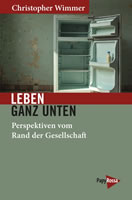 „Notunterkünfte, Teeküchen, Straßenecken: Christopher Wimmer sprach mit Menschen, die mit Armut und Ausgrenzung konfrontiert sind. Er lässt die Stimmen jener zu Wort kommen, die ganz unten leben und über deren Los meist von oben entschieden wird – mit ›Instrumenten‹ wie Hartz IV oder Bürgergeld, mit ›Leistungsanreizen‹ oder Sozialkürzungen. (…) Und wie gehen die Menschen, die Millionen zählen, mit Geldnot, Stigmatisierung oder Jobcenter-Schikanen um? Wimmer verwebt die persönlichen Geschichten aus seinen Interviews mit einer kritischen, materialistischen Gesellschaftsanalyse. (…) Durch die Verbindung aus journalistischer Darstellungsweise und soziologischem Blick entsteht ein vielschichtiges Bild von Armut, Ausgrenzung und eines täglichen Überlebenskampfs, der sich zwischen politischer Machtlosigkeit und widerständigem Alltag bewegt…“ PapyRossa Verlag zum Buch von Christopher Wimmer – siehe mehr Infos und als Leseprobe das Kap. 11: „SCHULD. Wie Debatten um Eigenverantwortung auch »ganz unten« wirken“:
„Notunterkünfte, Teeküchen, Straßenecken: Christopher Wimmer sprach mit Menschen, die mit Armut und Ausgrenzung konfrontiert sind. Er lässt die Stimmen jener zu Wort kommen, die ganz unten leben und über deren Los meist von oben entschieden wird – mit ›Instrumenten‹ wie Hartz IV oder Bürgergeld, mit ›Leistungsanreizen‹ oder Sozialkürzungen. (…) Und wie gehen die Menschen, die Millionen zählen, mit Geldnot, Stigmatisierung oder Jobcenter-Schikanen um? Wimmer verwebt die persönlichen Geschichten aus seinen Interviews mit einer kritischen, materialistischen Gesellschaftsanalyse. (…) Durch die Verbindung aus journalistischer Darstellungsweise und soziologischem Blick entsteht ein vielschichtiges Bild von Armut, Ausgrenzung und eines täglichen Überlebenskampfs, der sich zwischen politischer Machtlosigkeit und widerständigem Alltag bewegt…“ PapyRossa Verlag zum Buch von Christopher Wimmer – siehe mehr Infos und als Leseprobe das Kap. 11: „SCHULD. Wie Debatten um Eigenverantwortung auch »ganz unten« wirken“:
- [Buch] Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft
- Juli 2025, 197 Seiten, € 16,90 [D]
- ISBN 978-3-89438-859-1
- Siehe mehr Infos und Bestellung beim PapyRossa Verlag
 und dort auch Inhaltsverzeichnis
und dort auch Inhaltsverzeichnis 
 sowie Einleitung
sowie Einleitung 

- [Rezension] »Das gute Leben ist Ruhe«. Marginalisierung ist vielschichtig. Ein Versuch einer Aufarbeitung mit Betroffenen, abseits von Sozialromantik
„Der Rentner Herbert Kieserling isst manchmal ab nachmittags nichts mehr. »Ich bin ja älter, da braucht man nicht mehr so viel«, rechtfertigt er sich. Markus Nordkreuz, als DDR-Bürger nach der Wende nach Süddeutschland ausgewandert, geht selbst mit gebrochenem Zeh der sogenannten Schwarzarbeit nach. Nicht unbedingt, um sich ökonomisch abzusichern, sondern zum Schutz vor sozialer Verachtung. Ihm gelingt es trotzdem nicht, »die gesellschaftliche Wertschätzung zu erhalten, die allein der Lohnarbeit vorbehalten ist«. Helma Keitel, 53 Jahre alt, erwerbs- und obdachlos, fasst die Situation für sich und alle zusammen: »Die Armut bestimmt mein Leben und nicht andersrum.«
Kieserling, Nordkreuz und Keitel heißen tatsächlich anders. Sie sind drei von etwa zwei Dutzend Personen, die Christopher Wimmer für sein Buch »Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft« in Notunterkünften, Teestuben und an Straßenecken interviewt hat. Wimmer will die Sicht marginalisierter Menschen in Deutschland aufzeigen, ohne Sozialromantik anheimzufallen. (…)
Die Erzählung der Eigenverantwortung ermöglicht es ihnen, zumindest auf einer theoretischen Ebene etwas an der eigenen Situation zu ändern, vermutet Wimmer. Er begreift Armut dagegen als ein »Produkt von menschlicher Praxis, von Macht und Gehorsam, Herrschaft und Unterdrückung«. Der Staat benötigt arme Menschen demnach als ideologische Rechtfertigung. Sie dient dazu, Betroffene, andere Erwerbslose und Beschäftigte zu disziplinieren. (…) Wimmers Gesprächspartner*innen erzählen von diversen Praktiken der Widerständigkeit – Regelverstöße oder Wege, um bürokratische Hindernisse zu umgehen. Dahinter stehe der Versuch, »die eigene Handlungsfähigkeit in einer fremdbestimmten Situation zurückzugewinnen und sich gegen übermächtige Strukturen zu behaupten«. Motiviert werden sie, wenn ihre Erfahrungen ernst genommen werden. Dazu, so Wimmer, muss klar werden, dass Marginalisierung nicht auf individuelle Defizite, sondern auf die Funktionsweise des Kapitalismus zurückzuführen ist…“ Rezension von Sarah Yolanda Koss vom 07.10.2025 in ND online
Kap. 11: „SCHULD. Wie Debatten um Eigenverantwortung auch »ganz unten« wirken“
„Soziale Ungleichheit, deren extremste Form soziale Marginalisierung darstellt, ist eine Tatsache. Man kann sich ihr stellen, sie verdrängen oder diejenigen »ganz unten« für ihre Situation selbst verantwortlich machen. Die Folgen der letzten Alternative stelle ich auf den nächsten Seiten dar. Denn der Gedanke, dass arme und marginalisierte Menschen am Ende selbst für ihre Lage verantwortlich sind, findet sich nicht nur in den Parlamenten, in Zeitungsredaktionen oder an Stammtischen, sondern auch »ganz unten« in der Gesellschaft. Solche Stereotypen und Vorurteile über »faule Arbeitslose« und gesellschaftlichen Deutungsmuster wie »Jeder ist seines Glückes Schmied« sind mir auch meinen Gesprächen oft begegnet. Auch dort war das »Leistungsprinzip« und die Idee einer (uneingeschränkten) Selbstverantwortung allgegenwärtig. (…)
Dieser Wille, aus eigener Anstrengung eine marginalisierte Position wieder zu verlassen, durchzog viele Interviews. »Allen, die wollen, wird die Möglichkeit geboten, was zu machen, und wenn du es halt nicht machst, musste halt damit leben«, so etwa Jakob Simonon, für den die Verantwortung bei den Einzelnen lag: Wer hart genug arbeite, finde seinen Weg. Wer scheitere, habe es nicht genug versucht. Diese Haltung fand ihren praktischen Ausdruck darin, dass viele meiner Gesprächspartner:innen auch schlecht bezahlte oder unsichere Jobs – Putzen, Bauarbeit, Gastronomie, Dienstleistungen etc. – angenommen haben. Der Gelderwerb stand häufig erst an zweiter Stelle, in erster Linie ging es darum, es aus eigenem Antrieb zu schaffen, (wieder) ein Stückchen Normalität erlangen zu können. Ganz offenkundig sind die vorherrschenden Debatten um »Aktivierung« und »Eigenverantwortung« auch bei den Befragten höchst wirkmächtig.
Leistung, Leistung, Leistung
Aktivierung, Eigenverantwortung, Leistungsprinzip, Meritokratie. Diese Begriffe sind Teil eines gesellschaftlichen Diskurses, der der Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit dient. (…) Gleichzeitig wäre es jedoch verkürzt, die Äußerungen meiner Gesprächspartner:innen ausschließlich als Übernahme einer herrschenden Ideologie (»Meritokratie«) oder als Reaktion auf gesellschaftliche Verhältnisse (»autoritärer Kapitalismus«) zu verstehen.
Vielmehr konnten sie sich auf diese Weise selbst als handlungsfähig in einem sehr umfassenden Sinne darstellen. Aus ihren Bekundungen sprach der Glaube an die persönliche Wirkmächtigkeit. Darin bestand die wichtige Aufgabe solcher Sätze. Denn die Betonung des individuellen Willens zur Arbeit sowie der Bereitschaft, ›etwas leisten‹ zu wollen, schien meine Gesprächspartner:innen genau vor jenen gesellschaftlichen Vorurteilen zu schützen, denen sie alltäglich ausgesetzt sind, nämlich ›faul‹ oder ›unwillig zur Arbeit‹ zu sein. Daher richteten sie in den Interviews alles danach aus, sich als aktiv, handlungsfähig und arbeitswillig zu präsentieren. (…)
Dieser Makel, ›es nicht geschafft zu haben‹, durchzog die gesamten Biografien meiner Befragten und wurde zum Teil ihrer Subjektivität, ihres ›Charakters‹. Damit einher geht ein besonderer gesellschaftlicher Zynismus. Denn durch ihr ›Scheitern‹ entsprechen die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, genau jenen gesellschaftlichen Zuschreibungen, denen sie durch ihre leistungsorientierten Äußerungen zu entfliehen suchten. Auch bei marginalisierten Menschen werden ihre Armut und Ausgrenzung kaum mit strukturellen Ungleichheiten in Verbindung gebracht. Die liberale Logik uneingeschränkter Selbstverantwortung hat auch bei ihnen umfassend Eingang gefunden. (…)
Marginalisierte Menschen versuchen, gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen, indem sie auf bereits bestehende und bedeutende Vorstellungen zurückgreifen: Leistung, Anstand und Arbeit. Somit haben sie in einer auf Herrschaft und Ausbeutung gründenden Welt kaum Spielraum, eigene Vorstellungen und Ideen einzubringen…“ Kapitel 11 des Buches ![]() – wir danken Autor wie Verlag!
– wir danken Autor wie Verlag!
Bisher von Christopher Wimmer im LabourNet:
- [Buch von 2022] Lumpenproletariat. Die Unterklassen zwischen Diffamierung und revolutionärer Handlungsmacht
- [Buch von 2020] »Where have all the Rebels gone?« Perspektiven auf Klassenkampf und Gegenmacht
- und sehr viele verlinkte Artikel, wir empfehlen die Volltextrecherche


