- Afghanistan
- Afrika
- Ägypten
- Albanien
- Algerien
- Angola
- Antigua
- Äquatorialguinea
- Arabien - Arabische Welt
- Argentinien
- Armenien
- Aruba
- Aserbaidschan
- Asien
- Äthiopien
- Australien
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesch
- Barbados
- Belarus (Weißrussland)
- Belgien
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivien
- Bosnien-Herzegowina
- Botswana
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Dominica
- Dominikanische Republik
- Dschibuti
- Ecuador
- El Salvador
- Elfenbeinküste
- Eritrea
- Estland
- Europa
- Fidschi
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Gambia
- Georgien
- Germany
- Ghana
- Grenada
- Griechenland
- Großbritannien
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Kongo (Demokratische Republik)
- Kongo (Republik)
- Korea - Volksdemokratische Republik
- Kosovo
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos
- Latein- und Zentralamerika
- Lesotho
- Lettland
- Libanon
- Liberia
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Malta
- Marokko
- Mauretanien
- Mauritius
- Mexiko
- Moldawien / Republik Moldau
- Mongolei
- Montenegro
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Niger
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Oman
- Österreich
- Pakistan
- Palästinensische Gebiete - Westbank und Gaza
- Palau
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Ruanda
- Rumänien
- Russland
- Salomonen
- Sambia
- Sankt Lucia
- São Tomé und Principe
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Sudan
- Südkorea
- Südsudan
- Suriname
- Swasiland/Eswatini
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Tansania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Westsahara - Demokratische Arabische Republik Sahara
- Zentralafrikanische Republik
- Zypern
- Afghanistan
- Afrika
- Ägypten
- Albanien
- Algerien
- Angola
- Antigua
- Äquatorialguinea
- Arabien - Arabische Welt
- Argentinien
- Armenien
- Aruba
- Aserbaidschan
- Asien
- Äthiopien
- Australien
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesch
- Barbados
- Belarus (Weißrussland)
- Belgien
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivien
- Bosnien-Herzegowina
- Botswana
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Dominica
- Dominikanische Republik
- Dschibuti
- Ecuador
- El Salvador
- Elfenbeinküste
- Eritrea
- Estland
- Europa
- Fidschi
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Gambia
- Georgien
- Germany
- Ghana
- Grenada
- Griechenland
- Großbritannien
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Kongo (Demokratische Republik)
- Kongo (Republik)
- Korea - Volksdemokratische Republik
- Kosovo
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos
- Latein- und Zentralamerika
- Lesotho
- Lettland
- Libanon
- Liberia
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Malta
- Marokko
- Mauretanien
- Mauritius
- Mexiko
- Moldawien / Republik Moldau
- Mongolei
- Montenegro
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Niger
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Oman
- Österreich
- Pakistan
- Palästinensische Gebiete - Westbank und Gaza
- Palau
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Ruanda
- Rumänien
- Russland
- Salomonen
- Sambia
- Sankt Lucia
- São Tomé und Principe
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Sudan
- Südkorea
- Südsudan
- Suriname
- Swasiland/Eswatini
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Tansania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Westsahara - Demokratische Arabische Republik Sahara
- Zentralafrikanische Republik
- Zypern
- Afghanistan
- Afrika
- Ägypten
- Albanien
- Algerien
- Angola
- Antigua
- Äquatorialguinea
- Arabien - Arabische Welt
- Argentinien
- Armenien
- Aruba
- Aserbaidschan
- Asien
- Äthiopien
- Australien
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesch
- Barbados
- Belarus (Weißrussland)
- Belgien
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivien
- Bosnien-Herzegowina
- Botswana
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Dominica
- Dominikanische Republik
- Dschibuti
- Ecuador
- El Salvador
- Elfenbeinküste
- Eritrea
- Estland
- Europa
- Fidschi
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Gambia
- Georgien
- Germany
- Ghana
- Grenada
- Griechenland
- Großbritannien
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Kongo (Demokratische Republik)
- Kongo (Republik)
- Korea - Volksdemokratische Republik
- Kosovo
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos
- Latein- und Zentralamerika
- Lesotho
- Lettland
- Libanon
- Liberia
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Malta
- Marokko
- Mauretanien
- Mauritius
- Mexiko
- Moldawien / Republik Moldau
- Mongolei
- Montenegro
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Niger
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Oman
- Österreich
- Pakistan
- Palästinensische Gebiete - Westbank und Gaza
- Palau
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Ruanda
- Rumänien
- Russland
- Salomonen
- Sambia
- Sankt Lucia
- São Tomé und Principe
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Sudan
- Südkorea
- Südsudan
- Suriname
- Swasiland/Eswatini
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Tansania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Westsahara - Demokratische Arabische Republik Sahara
- Zentralafrikanische Republik
- Zypern
Wie Brasiliens Fleischindustrie von Sklavenarbeit profitiert – und nicht nur diese
Dossier
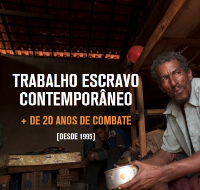 „Brasilianische Fleischkonzerne, die auch nach Deutschland exportieren, beziehen Fleisch von Farmen, die Arbeiter_innen unter sklavenähnlichen Bedingungen beschäftigen. Durch Kontrollen konnten im letzten Jahr 1.736 Personen aus Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft befreit werden. Die Dunkelziffer ist wohl zehn Mal höher. Zwei Giganten der brasilianischen Fleischindustrie, JBS und Marfig, kauften bei einem Rinderzüchter, lange nachdem ihn Inspekteur_innen des Wirtschaftsministeriums der Sklavenarbeit überführt hatten. Dies fand die brasilianische NRO Repórter Brasil, Partner des DGB Bildungswerk BUND, heraus, als sie die Bewegungen der Herde des Viehzüchters Maurício Pompeia Fraga für eine Recherche nachverfolgte. (…) In der „Schmutzigen Liste“ der Sklavenarbeit („Lista Suja“) listet das brasilianische Wirtschaftsministerium aktuell 92 Arbeitgeber auf, die in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 1.736 Personen unter sklavereiähnlichen Bedingungen beschäftigt haben. (…) In der jüngsten Veröffentlichung dieser Liste vom 5. April 2021 fanden sich 19 Arbeitgeber neu in der Liste wieder, die zusammen 231 Menschen ausgebeutet hatten. Die Unternehmen stammen aus der Textilindustrie, der Bauwirtschaft oder dem Bergbau – vor allem aber aus der Agrar- und Viehwirtschaft…“ Artikel von Daniel Camargos in der Übersetzung durch Mario Schenk am 07.06.2021 beim DGB Bildungswerk
„Brasilianische Fleischkonzerne, die auch nach Deutschland exportieren, beziehen Fleisch von Farmen, die Arbeiter_innen unter sklavenähnlichen Bedingungen beschäftigen. Durch Kontrollen konnten im letzten Jahr 1.736 Personen aus Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft befreit werden. Die Dunkelziffer ist wohl zehn Mal höher. Zwei Giganten der brasilianischen Fleischindustrie, JBS und Marfig, kauften bei einem Rinderzüchter, lange nachdem ihn Inspekteur_innen des Wirtschaftsministeriums der Sklavenarbeit überführt hatten. Dies fand die brasilianische NRO Repórter Brasil, Partner des DGB Bildungswerk BUND, heraus, als sie die Bewegungen der Herde des Viehzüchters Maurício Pompeia Fraga für eine Recherche nachverfolgte. (…) In der „Schmutzigen Liste“ der Sklavenarbeit („Lista Suja“) listet das brasilianische Wirtschaftsministerium aktuell 92 Arbeitgeber auf, die in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 1.736 Personen unter sklavereiähnlichen Bedingungen beschäftigt haben. (…) In der jüngsten Veröffentlichung dieser Liste vom 5. April 2021 fanden sich 19 Arbeitgeber neu in der Liste wieder, die zusammen 231 Menschen ausgebeutet hatten. Die Unternehmen stammen aus der Textilindustrie, der Bauwirtschaft oder dem Bergbau – vor allem aber aus der Agrar- und Viehwirtschaft…“ Artikel von Daniel Camargos in der Übersetzung durch Mario Schenk am 07.06.2021 beim DGB Bildungswerk ![]() , siehe dazu:
, siehe dazu:
- Die alltägliche Staatsgewalt in Brasilien: Mehr als die Hälfte der 210 Millionen Brasilianer stammt von Versklavten ab. Zur Lage des schwarzen Proletariats

„… Sindomésticos erreicht zwar nur einen Bruchteil der 7 Millionen Brasilianer*innen, die als Putzfrauen, Kindermädchen, Gärtner oder Chauffeure bei reichen Familien arbeiten. Doch der Warteraum im Gewerkschaftshaus ist voll: Mehr als ein Dutzend Personen – alles Frauen, fast alle schwarz, einige mit Kindern – sitzen unter einem großen Ventilator, warten auf die Rechtsberatung und lassen sich von einem Fernseher berieseln, auf dem Reportagen über Gang-Kriminalität und Polizeirazzien flimmern.
»Für Hausangestellte ist es sehr schwer, sich zu organisieren«, erläutert Martins, als sie eine Ecke im Büro für das Interview freigeräumt hat. Unter den Regierungen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei PT und vor allem durch ein Gesetz aus dem Jahr 2015, durch das Hausangestellte in das normale Arbeitsrecht integriert wurden, habe sich zwar einiges zum Besseren gewendet. »Trotzdem arbeiten die meisten nach wie vor ohne registrierten Vertrag«, erzählt Martins. »Viele kennen ihre Rechte nicht – oder haben Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie sich staatlich registrieren lassen.« Tatsächlich ist die Zahl der regulär beschäftigten Hausangestellten seit 2015 sogar gefallen: von 1,64 Millionen auf heute 1,34 Millionen Personen.
Das größte Hindernis gewerkschaftlicher Organisierung sei die Vereinzelung. »Viele von uns Älteren sind als Kinder zu der Familie gebracht worden, bei der wir arbeiten. Das heißt, wir sind praktisch entführt worden und haben entrechtet unter Fremden gewohnt.« Die wichtigste Aktivität der Gewerkschaft sei deshalb ein offenes Treffen am Sonntag, bei dem man andere Hausangestellte kennenlernen könne. (…) Mit der Frage, ob sie ihre Arbeit in der Tradition abolitionistischer Bewegungen, also der Kämpfe zur Abschaffung der Sklaverei sähen, wissen die beiden Gewerkschafter*innen sofort etwas anzufangen. Die Realität der Hausangestellten sei nicht zu trennen von der Geschichte der Sklaverei, die in Brasilien erst 1888 abgeschafft wurde. »Auf den Plantagen gab es zwei Arten von Sklaven: Die einen mussten auf den Feldern arbeiten, die anderen im Haushalt«, erklärt Martins. Nach der Sklaverei habe sich für viele faktisch wenig geändert: Auf den Plantagen und Fazendas blieben sie der Willkür ihrer Chefs ausgeliefert.
Für Martins, die keinen Hehl daraus macht, dass sie wie viele Hausangestellten sexualisierte Gewalt durch einen ihrer Arbeitgeber erlitten hat, sind die Klassenverhältnisse untrennbar mit Rassismus und Sexismus verknüpft: »Zwei Drittel von uns sind schwarz oder braun, viele verdienen weniger als den gesetzlichen Mindestlohn von 1500 Reais (233 Euro). Und lange hat man uns auch noch Unterkunft und Nahrungsmittel vom Lohn abgezogen – für ein stickiges Zimmer ohne Fenster.«
Weil Hausangestellte kaum erfolgreiche Arbeitskämpfe führen können, sind politische Reformen umso wichtiger. Auch aus diesem Grund identifizieren sich die Gewerkschafter*innen stark mit den PT-Regierungen. »Vor der Reform von 2015 mussten wir den ganzen Tag arbeiten, wenn der Chef das wollte«, erläutert Martins. »Das neue Gesetz schreibt feste Arbeitszeiten, bezahlte Überstunden, gesetzlichen Urlaub und eine Arbeitslosenversicherung vor.«.
Zum Staat haben die beiden Gewerkschafter*innen deshalb ein erstaunlich dialektisches Verhältnis: Wenn von Staatschef Lula die Rede ist, sprechen sie von »unseren Präsidenten«. Geht es hingegen um die politische Macht im Allgemeinen, fällt schnell der Begriff des »mörderischen Staates«. Tatsächlich führt die brasilianische Militärpolizei einen kaum verhohlenen Krieg gegen die schwarze Bevölkerung. Allein in Bahía, dem Bundesstaat mit dem höchsten Anteil an Afrobrasilianer*innen, erschoss die Polizei 2023 mehr Menschen als in den gesamten USA: 1700 Personen, die meisten von ihnen junge schwarze Männer…“ Artikel von Vanessa E. Thompson und Raul Zelik vom 25.06.2025 in ND online
- „Die Ratten fraßen unser Essen weg“: Neue „Schmutzige Liste“ legt Sklavenarbeit in Brasilien offen
„Kaffee, Baugewerbe und Kohleproduktion gehören zu den Branchen, die in das aktualisierte Register des Arbeitsministeriums aufgenommen wurden. Hunderte brasilianische Arbeiter_innen wurden aus unmenschlichen Bedingungen befreit. (…) Die 52 im Register aufgenommenen Arbeitgeber_innen werden für die Versklavung von 417 Arbeitnehmer_innen verantwortlich gemacht. Von den neuen Namen auf der Liste erhielten mindestens zehn die von der Regierung gezahlte Corona-Soforthilfe, die sich laut öffentlichen Statistiken auf umgerechnet 7230 Euro beläuft. (…) Mit der Aktualisierung der „schmutzige Liste“ umfasst das Register nun insgesamt 89 Arbeitgeber_innen, die in den letzten Jahren von der Arbeitsaufsicht gemeldet und nach Ausübung ihres Rechts auf Verteidigung in zwei Verwaltungsinstanzen aufgenommen wurden. Nach Artikel 149 des brasilianischen Strafgesetzbuchs gibt es vier Elemente, die moderne Sklaverei definieren: Zwangsarbeit (die eine Trennung vom Arbeitgeber unmöglich macht), Schuldknechtschaft (eine mit Schulden verbundene, oft betrügerische Knechtschaft), erniedrigende Bedingungen (Arbeit, die die Menschenwürde missachtet, sowie Gesundheit und Leben gefährdet) oder erschöpfende Arbeitszeiten (die den Arbeitnehmer_innen aufgrund der Intensität der Arbeit bis zur völligen Erschöpfung führen und auch seine Gesundheit und sein Leben gefährden). (…) Der Kaffeesektor ist mit 122 geretteten Arbeitnehmenden der Wirtschaftszweig mit der höchsten Anzahl von Arbeiter_innen, die sich in sklavereiähnlichen Verhältnissen befinden. Die zweithäufigste Tätigkeit war das Baugewerbe mit 50 geretteten Personen, gefolgt von der Holzkohleproduktion mit 46 Personen und der Viehzucht mit 26 Personen. Die von der Bundesregierung halbjährlich veröffentlichte „schmutzige Liste“ enthält auch fünf Opfer häuslicher Sklavenarbeit (…) Die „schmutzige Liste“ enthält Namen, die bei einer Inspektion zur Verantwortung gezogen werden, nachdem Arbeitgeber_innen die Möglichkeit hatten, sich gerichtlich in erster und zweiter Instanz gegen die Klage zu wehren. Die Arbeitgeber_innen bleiben zwei Jahre lang gelistet. Sie können jedoch eine Vereinbarung mit der Regierung unterzeichnen und aus dem Register gestrichen werden. Dazu müssen sie sich zu einer Reihe von arbeits- und sozialrechtlichen Anforderungen verpflichten. Obwohl die Verordnung, die diese Liste vorsieht, nicht zu einer Handels- oder Finanzblockade verpflichtet, wurde sie von brasilianischen und ausländischen Unternehmen für ihr Risikomanagement genutzt. Dies hat das Instrument zu einem weltweiten Beispiel im Kampf gegen Sklavenarbeit gemacht, das von den Vereinten Nationen anerkannt wurde. Im September 2020 bestätigte der Oberste Gerichtshof nach einer Klage der Vereinigung der Immobilienentwickler (Abrainc) mit neun zu null Stimmen die Verfassungsmäßigkeit der „schmutzigen Liste“. In der Klage wird argumentiert, dass das Register Arbeitgeber*innen unrechtmäßig bestraft, indem es ihre Namen offenlegt. Das Gericht wies dies mit der Begründung zurück, dass das Instrument Transparenz gewährleiste. Außerdem würden keine Sanktionen erlassen werden und Namen erst nach einem Verwaltungsverfahren mit dem Recht auf vollständige Verteidigung in das Register aufgenommen werden.“ Beitrag der DGB-Partnerorganisation Repórter Brasil in der Übersetzung von Niklas Franzen beim DGB-Bildungswerk online am 16. Mai 2022
- In Brasilien hat sich Zahl der Menschen in moderner Sklaverei verdoppelt – obwohl seit 1888 verboten
„… Die Sklavenarbeit nimmt in Brasilien weiter zu. Allein im letzten Jahr hat das Ministerium für Arbeit 1.937 Menschen aus sklavenähnlichen Bedingungen befreit. Dies ist ein neuer Höchststand seit 2013 und ein Anstieg um 106 Prozent zum Vorjahr. Vor allem die Agrarindustrie unterwirft Menschen der Zwangsarbeit. So haben 89 Prozent der Betroffenen in ländlichen Gebieten in sklavenähnlichen Verhältnissen gearbeitet. Allein 310 Personen in der Kaffeeproduktion. Aber auch in privaten Haushalten gibt es Sklavenarbeit. Im letzten Jahr sind 27 Frauen daraus befreit worden. Luiza Batista, Präsidentin des Nationalen Verbands der Hausangestellten, mahnt, dass diese Zahl nicht unterschätzt werden sollte. Das ist den Angaben des Arbeitministeriums zufolge ein Anstieg um 1.350 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre. „Die Zahl ist immer noch sehr unbedeutend im Verhältnis zu dem, was tatsächlich im Lande geschieht“, erklärte sie. „Viele Arbeiterinnen kommen aus dem Landesinneren, sie sind minderjährig. Die Mädchen folgen dem Versprechen, dass sie Arbeiten und Studieren werden. Aber dann ist nichts so. Das Studium existiert nicht, und die Bezahlung bleibt nur ein Versprechen.“ Der enorme Anstieg an geretteten Personen ist vor allem durch die Zunahme von Kontrollen im vergangenen Jahr zu erklären. Das brasilianische Institut für Geografie und Statistik zeigt auf, dass 6,2 Millionen Brasilianer:innen als Hausangestellte arbeiten. Davon haben jedoch nur 28 Prozent eine tatsächliche Anstellung. 92 Prozent der Opfer von häuslicher Sklaverei sind Frauen und 68 Prozent sind Personen, die sich als Schwarz bezeichnen. Die aktuelle Regierung unter Jair Bolsonaro und die vergangene des De-facto-Präsidenten Michel Temer haben versucht, die Bekämpfung der Sklavenarbeit zu bremsen. Temer versuchte, die Definition der Zwangsarbeit auf die Verletzung des „freien Kommen und Gehen“ zu reduzieren. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens (STF) hielt dagegen. So gelten die Bestimmungen der Schuldknechschaft, Erschöpfung durch lange Arbeitszeiten und erniedrigende Arbeitsbedingungen immer noch als sklavenähnliche Zustände (…).Insgesamt wurden seit 1995 57.000 Menschen aus der Sklaverei befreit. In Brasilien ist Sklavenarbeit seit 1888 verboten. Jedoch besteht das koloniale Erbe weiter fort. (…) Obwohl die Sklaverei nach Artikel 149 des brasilianischen Strafgesetzbuches verboten und unter Strafe gestellt ist, werden kaum Fälle von häuslicher Sklaverei bekannt…“ Beitrag von Anne Hellmund vom 10. Februar 2022 bei amerika21
- Billiges Fleisch, billiger Saft, niedrige Löhne: Der Kampf gegen Schuldknechtschaft in Brasilien hat unter der Regierung von Jair Bolsonaro herbe Rückschläge erfahren
 „Unter dem Präsidenten Luiz Inácio »Lula« da Silva gab es in Brasilien etliche Fortschritte im Kampf gegen extreme Ausbeutung im Land. So wurden sklavereiähnliche Arbeitsverhältnisse durch einen Zusatzartikel im Strafrecht verboten. Eine mobile Sonderinspektion wurde geschaffen, 2003 und 2008 wurden nationale Pläne zur Abschaffung der Sklavenarbeit beschlossen. (…) [Seit] Amtsantritt des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro Anfang 2019 ist die Bekämpfung ausbeuterischer Verhältnisse um Jahre zurückgeworfen. Der Lage im größten Land Südamerikas ist ein Kapitel im »Atlas der Versklavung« gewidmet. Demnach wurden die Mittel für den Kampf gegen Sklavenarbeit 2020 um 41 Prozent gekürzt. Im Atlas wird ein Fall geschildert, über den 2018 der Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte urteilte. Arbeiter einer Rinderfarm im Bundesstaat Pará im Norden des Landes hatten den brasilianischen Staat wegen Vernachlässigung seiner Schutzpflichten verklagt. Entgegen vorheriger Versprechungen erhielten sie extrem niedrige oder gar keine Lohnzahlungen. Ihnen wurde erklärt, die Entgelte, würden für die Abzahlung von Schulden einbehalten, die sie beim Inhaber des Betriebes hätten. Für den Fall, dass sie versuchen sollten, die Farm zu verlassen, wurde ihnen mit dem Tod gedroht. Zudem waren sie unter unwürdigsten Bedingungen untergebracht. Obwohl Inspektoren die Ranch seit 1989 nach Beschwerden von Arbeitern immer wieder aufsuchten, änderte sich nie etwas. 1997 kam es zwar zu Strafverfahren gegen den Personalvermittler, den Verwalter und den Eigentümer der Farm. Das Verfahren gegen letzteren wurde gegen Zahlung eines Bußgelds eingestellt, die anderen Beschuldigten profitierten von einer Verjährungsfrist, die zum Tragen kam, weil das Gericht so lange untätig geblieben war. Ähnlich lief es bei einem weiteren Verfahren. Der Interamerikanische Gerichtshof verurteilte den brasilianischen Staat zur Zahlung von Schadenersatz an 128 Opfer von Zwangsarbeit und forderte, das strafrechtliche Verfahren müsse wieder aufgenommen, die verschiedenen Formen der Sklaverei von der Verjährung ausgenommen werden. In den letzten 25 Jahren wurden in Brasilien mehr als 56 000 Menschen aus sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen befreit, die nicht nur im Agrarsektor, sondern auch im Bergbau, in der Bau- und in der Bekleidungsbranche an der Tagesordnung sind…“ Artikel von Jana Frielinghaus vom 10. November 2021 in neues Deutschland online
„Unter dem Präsidenten Luiz Inácio »Lula« da Silva gab es in Brasilien etliche Fortschritte im Kampf gegen extreme Ausbeutung im Land. So wurden sklavereiähnliche Arbeitsverhältnisse durch einen Zusatzartikel im Strafrecht verboten. Eine mobile Sonderinspektion wurde geschaffen, 2003 und 2008 wurden nationale Pläne zur Abschaffung der Sklavenarbeit beschlossen. (…) [Seit] Amtsantritt des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro Anfang 2019 ist die Bekämpfung ausbeuterischer Verhältnisse um Jahre zurückgeworfen. Der Lage im größten Land Südamerikas ist ein Kapitel im »Atlas der Versklavung« gewidmet. Demnach wurden die Mittel für den Kampf gegen Sklavenarbeit 2020 um 41 Prozent gekürzt. Im Atlas wird ein Fall geschildert, über den 2018 der Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte urteilte. Arbeiter einer Rinderfarm im Bundesstaat Pará im Norden des Landes hatten den brasilianischen Staat wegen Vernachlässigung seiner Schutzpflichten verklagt. Entgegen vorheriger Versprechungen erhielten sie extrem niedrige oder gar keine Lohnzahlungen. Ihnen wurde erklärt, die Entgelte, würden für die Abzahlung von Schulden einbehalten, die sie beim Inhaber des Betriebes hätten. Für den Fall, dass sie versuchen sollten, die Farm zu verlassen, wurde ihnen mit dem Tod gedroht. Zudem waren sie unter unwürdigsten Bedingungen untergebracht. Obwohl Inspektoren die Ranch seit 1989 nach Beschwerden von Arbeitern immer wieder aufsuchten, änderte sich nie etwas. 1997 kam es zwar zu Strafverfahren gegen den Personalvermittler, den Verwalter und den Eigentümer der Farm. Das Verfahren gegen letzteren wurde gegen Zahlung eines Bußgelds eingestellt, die anderen Beschuldigten profitierten von einer Verjährungsfrist, die zum Tragen kam, weil das Gericht so lange untätig geblieben war. Ähnlich lief es bei einem weiteren Verfahren. Der Interamerikanische Gerichtshof verurteilte den brasilianischen Staat zur Zahlung von Schadenersatz an 128 Opfer von Zwangsarbeit und forderte, das strafrechtliche Verfahren müsse wieder aufgenommen, die verschiedenen Formen der Sklaverei von der Verjährung ausgenommen werden. In den letzten 25 Jahren wurden in Brasilien mehr als 56 000 Menschen aus sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen befreit, die nicht nur im Agrarsektor, sondern auch im Bergbau, in der Bau- und in der Bekleidungsbranche an der Tagesordnung sind…“ Artikel von Jana Frielinghaus vom 10. November 2021 in neues Deutschland online 
- Siehe auch vom Oktober 2017: Brasilianische Putschregierung will den Kampf gegen Sklavenarbeit beenden: Einer der deutschen Profiteure heißt Haribo und darin u.a.:
- „Brazil Backtracks on Anti-Slavery Policies“ am 22. Oktober 2017 ebenfalls bei Freedom United
 ist ein kurzer Beitrag über die Neudefinition von „Sklavenarbeit“ durch die brasilianische Regierung, die etwa eine solche Definition nun daran bindet, dass die Beschäftigten gezwungen würden, an einem bestimmten Ort zu leben. Bisher reichten dafür solche Kriterien aus, wie gezwungen sein bestimmte Arbeiten zu leisten, um Schulden ab zu bezahlen…Eine Reform die, so der Beitrag, den Interessen des in Brasilien so mächtigen Agrarkapitals entspreche…
ist ein kurzer Beitrag über die Neudefinition von „Sklavenarbeit“ durch die brasilianische Regierung, die etwa eine solche Definition nun daran bindet, dass die Beschäftigten gezwungen würden, an einem bestimmten Ort zu leben. Bisher reichten dafür solche Kriterien aus, wie gezwungen sein bestimmte Arbeiten zu leisten, um Schulden ab zu bezahlen…Eine Reform die, so der Beitrag, den Interessen des in Brasilien so mächtigen Agrarkapitals entspreche… - „VW-Sklavenarbeit in Brasilien: Welthaus Bielefeld wies bereits 1984 auf Zustände hin“ vom 11. August 2017
 ist eine Pressemitteilung des Welthauses, in der zur aktuellen Berichterstattung über frühere Sklavenarbeiten, die keineswegs nur in einem irgendwie abgetrennten agrarkapitalistischen Sektor bittere Realität war und ist: „WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichteten am 11. August 2017 über eine Rinder-Farm des Autokonzerns Volkswagen in Brasilien, bei in den 1980iger Jahren Landarbeiter wie Sklaven behandelt wurden. Die im Amazonasgebiet gelegene Farm „Vale do Rio Cristalino“ ist jedoch nicht erst seit heute für diese Praktiken bekannt. Das Welthaus Bielefeld informierte bereits 1984 über die massiven Vorwürfe gegenüber dem VW-Unternehmen – mit großem Echo in der entwicklungspolitisch interessierten Öffentlichkeit der 80er Jahre. In die öffentlich-rechtlichen Medien schaffte es das Thema damals jedoch nicht. (…) Unter dem Titel „Die Farm am Amazonas“ fasste damals das Welthaus Bielefeld den Kenntnisstand aus mehreren Quellen zusammen und machte das Thema damit der deutschsprachigen Öffentlichkeit zugänglich. Die mehrere tausend Exemplare waren schnell vergriffen. Herausgeber des Info-Heftes war die „Arbeitsgruppe Brasilien“, eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen des damals noch unter dem Namen „Dritte Welt Haus“ firmierenden Welthauses Bielefeld. So veröffentlichte das Informationsheft auch einen ins Deutsche übersetzen Ausschnitt eines Artikels der brasilianischen Zeitung „O Sao Paulo“ vom 3. Juni 1983. Landarbeiter berichteten darin als Zeugen von der massiven Gewalt und von Sklaverei ähnlichen Zuständen auf der Farm. Die Vorwürfe waren auch damals dem VW-Konzern nicht unbekannt, wie das Heft berichtet. Es habe sogar eine Einladung von brasilianischen Kritikern auf die Farm gegeben, bei der alle Vorwürfe von Vertretern der Farm und der Wolfsburger PR-Abteilung von VW zurückgewiesen worden seien. Die Recherchen von WDR, NDR und SZ bestätigten nun, dass auch die Konzernspitze in Wolfsburg spätestens im Jahr 1983 über Vorwürfe gegen die Farm informiert worden war. Helmut Hagemann, Vertreter der damaligen Welthaus-Bielefeld-Gruppe kommentiert: „Medien haben sich damals nicht interessiert. Gut, dass das Thema jetzt nochmal auf den Tisch kommt!“ “.
ist eine Pressemitteilung des Welthauses, in der zur aktuellen Berichterstattung über frühere Sklavenarbeiten, die keineswegs nur in einem irgendwie abgetrennten agrarkapitalistischen Sektor bittere Realität war und ist: „WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichteten am 11. August 2017 über eine Rinder-Farm des Autokonzerns Volkswagen in Brasilien, bei in den 1980iger Jahren Landarbeiter wie Sklaven behandelt wurden. Die im Amazonasgebiet gelegene Farm „Vale do Rio Cristalino“ ist jedoch nicht erst seit heute für diese Praktiken bekannt. Das Welthaus Bielefeld informierte bereits 1984 über die massiven Vorwürfe gegenüber dem VW-Unternehmen – mit großem Echo in der entwicklungspolitisch interessierten Öffentlichkeit der 80er Jahre. In die öffentlich-rechtlichen Medien schaffte es das Thema damals jedoch nicht. (…) Unter dem Titel „Die Farm am Amazonas“ fasste damals das Welthaus Bielefeld den Kenntnisstand aus mehreren Quellen zusammen und machte das Thema damit der deutschsprachigen Öffentlichkeit zugänglich. Die mehrere tausend Exemplare waren schnell vergriffen. Herausgeber des Info-Heftes war die „Arbeitsgruppe Brasilien“, eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen des damals noch unter dem Namen „Dritte Welt Haus“ firmierenden Welthauses Bielefeld. So veröffentlichte das Informationsheft auch einen ins Deutsche übersetzen Ausschnitt eines Artikels der brasilianischen Zeitung „O Sao Paulo“ vom 3. Juni 1983. Landarbeiter berichteten darin als Zeugen von der massiven Gewalt und von Sklaverei ähnlichen Zuständen auf der Farm. Die Vorwürfe waren auch damals dem VW-Konzern nicht unbekannt, wie das Heft berichtet. Es habe sogar eine Einladung von brasilianischen Kritikern auf die Farm gegeben, bei der alle Vorwürfe von Vertretern der Farm und der Wolfsburger PR-Abteilung von VW zurückgewiesen worden seien. Die Recherchen von WDR, NDR und SZ bestätigten nun, dass auch die Konzernspitze in Wolfsburg spätestens im Jahr 1983 über Vorwürfe gegen die Farm informiert worden war. Helmut Hagemann, Vertreter der damaligen Welthaus-Bielefeld-Gruppe kommentiert: „Medien haben sich damals nicht interessiert. Gut, dass das Thema jetzt nochmal auf den Tisch kommt!“ “. - „Temer distorce ação de resgate de escravos ao justificar nova portaria“ von Piero Locatelli und Leonardo Sakamoto am 20. Oktober 2017 bei Reporter Brasil
 ist ein Beitrag über ein Fernsehinterview des sogenannten Präsidenten, in dem der Mann behauptete, die bisherige Feststellung sklavereiähnlicher Bedingungen sei übertrieben – etwa, wenn dies geschehe, weil keine Seife zur Verfügung stehe. Die Autoren von Reporter Brasil, eine Redaktion, die sich seit langem dem Kampf gegen moderne Sklaverei gewidmet hat, weisen nach, dass es sich dabei wieder einmal um eine Lüge handelt. Der von Temer angeführte Fall des Unternehmens MRV Engenharia sei in der Tat von der Inspektion als ein Fall sklavereiähnlicher Bedingungen geahndet worden. Nur habe es dabei mehr als 40 bestätigte Anklagepunkte gegeben, unter anderem nicht ausbezahlte Löhne und zahlreiche konkrete Zwangsmechanismen, von denen die mangelnden Hygiene-Einrichtungen (und keineswegs nur fehlende Seife) eben nur einer der angeführten Punkte gewesen sei…
ist ein Beitrag über ein Fernsehinterview des sogenannten Präsidenten, in dem der Mann behauptete, die bisherige Feststellung sklavereiähnlicher Bedingungen sei übertrieben – etwa, wenn dies geschehe, weil keine Seife zur Verfügung stehe. Die Autoren von Reporter Brasil, eine Redaktion, die sich seit langem dem Kampf gegen moderne Sklaverei gewidmet hat, weisen nach, dass es sich dabei wieder einmal um eine Lüge handelt. Der von Temer angeführte Fall des Unternehmens MRV Engenharia sei in der Tat von der Inspektion als ein Fall sklavereiähnlicher Bedingungen geahndet worden. Nur habe es dabei mehr als 40 bestätigte Anklagepunkte gegeben, unter anderem nicht ausbezahlte Löhne und zahlreiche konkrete Zwangsmechanismen, von denen die mangelnden Hygiene-Einrichtungen (und keineswegs nur fehlende Seife) eben nur einer der angeführten Punkte gewesen sei… - „Oposição quer anular portaria do governo que dificulta combate ao trabalho escravo“ am 19. Oktober 2017 beim Gewerkschaftsbund CUT
 ist ein Beitrag über die Initiativen oppositioneller Parlamentsabgeordneter gegen den Erlass der Temer-Regierung zur Neudefinition von Sklavenarbeit. Der Erlass 1129 der Regierung war am 16. Oktober 2017 veröffentlicht worden und steht seitdem heftig in der Kritik aller irgendwie demokratischer und progressiver Kräfte, weit über die Gewerkschaftsbewegung hinaus. Das Problem, dass diese Regierung mit ihrer Maßnahme für die Unternehmen hat ist, dass die bisherige Regelung, beziehungsweise Definition, Bestandteil des Strafgesetzbuches ist – und damit eine Gesetzeskraft hat, die nicht durch bloße Erlasse verändert werden kann…
ist ein Beitrag über die Initiativen oppositioneller Parlamentsabgeordneter gegen den Erlass der Temer-Regierung zur Neudefinition von Sklavenarbeit. Der Erlass 1129 der Regierung war am 16. Oktober 2017 veröffentlicht worden und steht seitdem heftig in der Kritik aller irgendwie demokratischer und progressiver Kräfte, weit über die Gewerkschaftsbewegung hinaus. Das Problem, dass diese Regierung mit ihrer Maßnahme für die Unternehmen hat ist, dass die bisherige Regelung, beziehungsweise Definition, Bestandteil des Strafgesetzbuches ist – und damit eine Gesetzeskraft hat, die nicht durch bloße Erlasse verändert werden kann… - „O maior ataque à fiscalização de combate ao trabalho escravo no Brasil“ von Lucas Reis da Silva am 18. Oktober 2017 bei Esquerda Online
 ist der Beitrag eines langjährigen Mitglieds der Inspektion zur Sklavenarbeit über die Gegenreform der Regierung, in dem neben der Ungesetzlichkeit einer Veränderung des Strafgesetzbuches durch ein diktiertes Dekret vor allem praktische Erfahrungen im Mittelpunkt stehen – die zu Erfolgen führten, wie etwa die Befreiung von 55.000 Menschen aus solchen Arbeitsbedingungen in den Jahren der Gültigkeit des Gesetzes.
ist der Beitrag eines langjährigen Mitglieds der Inspektion zur Sklavenarbeit über die Gegenreform der Regierung, in dem neben der Ungesetzlichkeit einer Veränderung des Strafgesetzbuches durch ein diktiertes Dekret vor allem praktische Erfahrungen im Mittelpunkt stehen – die zu Erfolgen führten, wie etwa die Befreiung von 55.000 Menschen aus solchen Arbeitsbedingungen in den Jahren der Gültigkeit des Gesetzes. - „Conheça 9 marcas famosas envolvidas com trabalho escravo“ von Amanda Navarro am 18. Oktober 2017 bei Esquerda Diario
 ist ein Beitrag über 9 Marken-Unternehmen, die von der Sklavenarbeit profitieren – unter anderem die „Trendsetter“ der brasilianischen Fleischindustrie, aber auch zahlreiche nationale wie internationale Modeunternehmen, die in Brasilien zumeist die Arbeit bolivianischer Frauen ausbeuten…
ist ein Beitrag über 9 Marken-Unternehmen, die von der Sklavenarbeit profitieren – unter anderem die „Trendsetter“ der brasilianischen Fleischindustrie, aber auch zahlreiche nationale wie internationale Modeunternehmen, die in Brasilien zumeist die Arbeit bolivianischer Frauen ausbeuten…
- „Brazil Backtracks on Anti-Slavery Policies“ am 22. Oktober 2017 ebenfalls bei Freedom United
Siehe aus dem LabourNet-Archiv zum Thema:
- Verheerende Arbeitsbedingungen: Zara soll Zwangsarbeiter beschäftigen
„Gegen die Modekette Zara erhebt die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe: So sollen in einem Betrieb in São Paulo Arbeitnehmer unter Bedingungen beschäftigt werden, die an Sklaverei grenzten. Der Mutterkonzern Inditex räumt inzwischen Unregelmäßigkeiten ein…“ Meldung auf N-TV vom 18.08.2011


