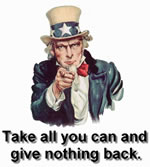
„..
. „Die Globalisierungsfalle“, in der Harald Schumann und ich vor dem „Angriff auf Demokratie und Wohlstand“ warnten, erwies sich leider in vielem als Prognose. Nunmehr heißt es „Game Over“, für den Westen, für unser Zivilisationsmodell. Kapitalismus funktioniert auch ohne Demokratie und ohne Einhaltung liberaler Menschenrechte. Die Volksrepublik China ist mit ihrem kapitalistischen Überwachungskommunismus der wahre Sieger nach dem Kalten Krieg und die größte Gefahr für eine Zukunft in Freiheit. Wie konnten wir nur so versagen? Mit Hyperglobalisierung und Digitalisierung, Börsenkrachs, Klimawandel und Massenmigration knicken alle vier Säulen unserer bisherigen Demokratien ein: die Legislative, die Exekutive, die Judikative und die sogenannte „vierte Gewalt“, die Medien. Die liberale Demokratie ohne stabiles soziales Fundament erweist sich als Fehlkonstruktion. Unhaltbare wirtschaftliche Ungleichheit und allgegenwärtige Unsicherheit münden in nationalen Chauvinismus. Die Kriegsspirale dreht sich. Das ist kein Zukunftsszenario. Es geschieht jetzt. Wir befinden uns mitten in einer Global-Revolution. Der Trumpismus – auch ohne Trump – wird nicht kommen, er ist da. Die Wohnungen werden nicht unbezahlbar werden, sie sind es. In vielen EU-Staaten droht nicht die Wahl rechtsnationaler Regierungen, sie sind bereits an der Macht. Aufwachen…“ Auszug aus „Game over“ von Hans-Peter Martin bei Telepolis vom 24. September 2018 – „Game Over – Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle – und dann?“
weiterlesen »