- Alltagswiderstand und Commons
- Bündnis Umfairteilen und Aktionen
- Die Occupy-Bewegung und Aktionstage
- Gewerkschaftliche Mobilisierung in der Krise
- Initiativen der Linken gegen den Kapitalismus und dessen Krisen
- Interventionen gegen die neoliberale EU
- Mobilisierungsdebatte: Wie kämpfen (gegen Kapitalismus)?
- Proteste gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21
[Buch] Klimakollaps und soziale Kämpfe
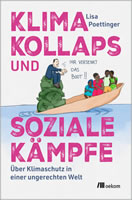 „Die Klimakrise ist nicht nur eine Umweltkatastrophe, sie ist ein Gerechtigkeitsproblem. Frauen, indigene Gemeinschaften und Menschen im Globalen Süden tragen die Hauptlast, während große Konzerne von einem ausbeuterischen System profitieren. Die Aktivistin Lisa Poettinger zeigt, warum Klimaschutz nur mit sozialer Gerechtigkeit funktioniert. Sie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit radikaler Praxis und liefert Denkanstöße für echte Veränderung. Wer sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, braucht Mut. Dieses Buch zeigt, warum es sich lohnt.“ Umschlagtext zum Buch von Lisa Poettinger im oekom-Verlag mit Illustrationen der Autorin über Klimaschutz in einer ungerechten Welt. Warum die Klimakrise auch eine Frage der Gerechtigkeit ist – Aktivismus, Widerstand und Wege zu echter Veränderung. Siehe mehr Informationen zum im August 2025 erscheinenden Buch und als Vorab-Leseprobe im LabourNet das Teilkapitel zum Thema „Wettbewerb & Wachstum“*:
„Die Klimakrise ist nicht nur eine Umweltkatastrophe, sie ist ein Gerechtigkeitsproblem. Frauen, indigene Gemeinschaften und Menschen im Globalen Süden tragen die Hauptlast, während große Konzerne von einem ausbeuterischen System profitieren. Die Aktivistin Lisa Poettinger zeigt, warum Klimaschutz nur mit sozialer Gerechtigkeit funktioniert. Sie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit radikaler Praxis und liefert Denkanstöße für echte Veränderung. Wer sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, braucht Mut. Dieses Buch zeigt, warum es sich lohnt.“ Umschlagtext zum Buch von Lisa Poettinger im oekom-Verlag mit Illustrationen der Autorin über Klimaschutz in einer ungerechten Welt. Warum die Klimakrise auch eine Frage der Gerechtigkeit ist – Aktivismus, Widerstand und Wege zu echter Veränderung. Siehe mehr Informationen zum im August 2025 erscheinenden Buch und als Vorab-Leseprobe im LabourNet das Teilkapitel zum Thema „Wettbewerb & Wachstum“*:
- Buch von Lisa Poettinger: Klimakollaps und soziale Kämpfe
- ISBN: 978-3-98726-148-0
- Softcover, 212 Seiten
- 18,00 €
- Erscheinungstermin: 06.08.2025
- Informationen und Bestellung beim oekom-Verlag

- Und dort als Leseprobe

 Inhaltsverzeichnis, Vorwort und das Kapitel „Globale Klima(un)gerechtigkeit“
Inhaltsverzeichnis, Vorwort und das Kapitel „Globale Klima(un)gerechtigkeit“ - Die dankenswerte Vorab-Leseprobe im LabourNet Germany ist das Teilkapitel zum Thema „Wettbewerb & Wachstum“ (S. 71 bis 80):
Wettbewerb & Wachstum
Die Eigentümer:innen von Konzernen konkurrieren miteinander. Wenn ihre Produkte weniger kosten als die ihrer Konkurrent:innen, sind sie erfolgreicher, da dann mehr Menschen diese billigeren Produkte kaufen werden. So erreichen sie höhere Profite, die sie wiederum in die Produktion investieren können, um noch mehr zu verkaufen. Um Waren günstiger anbieten zu können, braucht es Innovation: Möglichkeiten mehr des Gleichen mit weniger Arbeitskraftaufwand zu verkaufen, z. B. durch Robotisierung – und Ausbeutung: die billige (Aus-)Nutzung von Natur und Arbeitskraft.
Wenn ein Konzern es schafft, billiger als die anderen zu verkaufen, müssen die anderen nachziehen. Anderenfalls werden sie vom Markt verdrängt, da weniger Menschen ihre teureren Produkte kaufen werden.
Und so muss immer mehr und mehr produziert werden, was mit den planetaren Grenzen nicht vereinbar ist. Ressourcen werden übernutzt; jede Produktion führt zu Emissionen.
Konzerne müssen immer weiter verkaufen. Auf einem schwächelnden Automarkt, in dem viele Menschen bereits ein Auto besitzen, stellen Elektroautos deshalb eine neue Marktchance dar.
Obwohl sie in der Regel meist als Zweit- oder sogar Drittauto genutzt werden, werden Elektroautos in Werbung und Politik oft als die nachhaltige Alternative zu motorisierten Autos dargestellt. Als ob das nicht reichen würde, geht die hoch emittierende Produktion von Elektroautos mit neokolonialer Ausbeutung einher.
Die heutigen Ausbeutungsverhältnisse zwischen globalem Norden und globalem Süden werden häufig als neokolonial oder imperialistisch bezeichnet, da der Kolonialismus zwar offiziell beendet ist, Machtausübung und Ausbeutung aber fortbestehen. Im Fall von Elektroautos geht es beispielsweise um die Vertreibung von Menschen aus ihren angestammten Ländern für den umweltzerstörenden Abbau von Lithium für Batterien.
Elektroautos als die Lösung zu bewerben ist nichts anderes als Greenwashing. Greenwashing heißt umweltzerstörenden Konzernen, Handlungen oder Produkten ein grünes Image zu verleihen und so zu tun, als wären diese nachhaltig. Konkurrenz macht Wachstum notwendig, was oft zur Überproduktion führt: Es wird mehr produziert als das, was Menschen kaufen.
Wie man (Über-)Produktion los wird & ein gutes Geschäft damit macht
- Kleidung → verbrennen; lohnt sich, denn Arbeiterinnen aus Bangladesh bekommen sowieso kaum Lohn
- Autos → »Umweltprämie« 2009: Individuen 2.500 € schenken, wenn sie ihr altes Auto verschrotten lassen und durch ein neues, »umweltfreundliches« Auto ersetzen = 5 Mrd. € Steuergeld von der Gesellschaft an Konzerne (statt ÖPNV)
- in anderen Ländern verkaufen (+ zerstört deren Märkte)
- geplante Obsoleszenz: Dinge so produzieren, dass sie früher kaputtgehen
- psychologische Obsoleszenz: Dinge überholt wirken lassen
- Konkurrenz & ihre Produkte attackieren → macht eigene Produkte attraktiver
- Infrastruktur nur für unser Produkt nutzbar machen
- …
Unendliches Wachstum geht mit Ausdehnung einher (siehe S. 67) und damit: (Quasi-)Privatisierung. Wälder und andere Ökosysteme werden immer wieder davon bedroht, für Fabriken, Transportstraßen und andere kommerzialisierende Infrastruktur zerstört zu werden. Oft geht dies auch mit Militarisierung einher, besonders an Orten, wo mit Widerstand zu rechnen ist oder lokale Gemeinschaften »zu unabhängig« leben.
Der Tren Maya (dt. Maya-Zug) ist ein 1.500 km langes Megaprojekt, das die letzten Dschungel in Mexiko zerstört, indigene (Land-) Rechte durch Vertreibung, Militarisierung und Landraub verletzt. Deutsche Konzerne wie die Deutsche Bahn sind ebenfalls involviert.
2020 wurden trotz massiver Proteste inklusive einer Waldbesetzung weite Teile des staatlichen Dannenröder Waldes in Deutschland zerstört, um eine Autobahn zu bauen, die Ferrero als Transportroute dient.
Befürworter:innen von grünem Kapitalismus oder grünem Wachstum behaupten, Umweltverschmutzung und -übernutzung könnte von Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Es könne also grünes Wachstum geben.
Die Idee, dass technologische Veränderungen und Substitutionen Wirtschaftswachstum von Ressourcennutzung und CO2-Emissionen entkoppeln würden, zeigt sich auch in den UN Sustainable Development Goals (SDGs, dt. Ziele für nachhaltige Entwicklung) der UN, unter denen das SDG 8 für Wachstum steht.
Diese Idee wurde widerlegt: Grünes Wachstum innerhalb planetarer Grenzen hinsichtlich »Materialien, Energie, Wasser, Treibhausgasen, Land, Wasserverschmutzungen und dem Verlust an Artenvielfalt« ist nicht plausibel (siehe S. 93–97).
Tauschwertproduktion
Im Kapitalismus wird hauptsächlich anhand des Tauschwertes produziert. Das ist anders als eine Produktion anhand des Gebrauchswertes. Das heißt, dass im Kapitalismus Dinge nicht primär produziert werden, um sie anhand menschlicher Bedürfnisse zu nutzen wie z. B. Medikamente oder eine zugängliche Mobilitätsinfrastruktur. Dinge werden für ihren Tauschwert produziert, egal wie nützlich sie sind. Was verkauft werden kann, wird also produziert: SUVs, 1.000 verschiedene Smartphonehüllen, Toiletten- und Haustier-Accessoires, leicht zerbrechliches Geschirr usw. Sie werden hergestellt und auf eine Weise vermarktet, dass Menschen sie kaufen wollen.
Produktion ist aber immer mit Emissionen und der Nutzung von Ressourcen verbunden. Gleichzeitig gibt es oft Engpässe bei Medikamenten für seltene Krankheiten, bei Bussen, Solarpanelen etc. Dass es keine gesellschaftliche Entscheidung über die Produktion gibt, liegt an den Klassen im Kapitalismus.
Die Klassenspaltung
Die Geschichte wurde schon immer durch eine Form von Klassenkampf geprägt, egal ob versklavte Menschen und ihre Herrscher oder »Kapitalisten und Proletarier«. Diese Begriffe erscheinen heutzutage alt, verstaubt und unpassend.
Es lohnt sich jedoch, sich selbst zu fragen:
- Gehört mir ein (großer Anteil von einem) Großkonzern?
- Bin ich ein Top-Manager von einem solchen Konzern? Shell? BP? RWE? Cargill? Tesla? Blackrock?
- Kann ich entscheiden, was produziert wird?
- Kann ich mir einen Bunker bauen, um mich vor dem Klima- & Sozialkollaps zu schützen?
Grob gesagt: Wenn man für das eigene Geld arbeiten muss und nicht primär das eigene Vermögen für sich arbeiten lassen kann, dann ist man höchstwahrscheinlich ein:e lohnabhängige:r Beschäftigte:r (oder die eigenen Eltern, Vormünder oder Ehepartner:innen sind es).
In diesem Fall ist man kein »Kapitalist«. Ein:e Kapitalist: in ist ein Mensch, der die »Produktionsmittel« besitzt, z. B. einen Konzern, eine Fabrik, eine Bank, ein relevant großes Stück Land, eine relevante Menge an Aktien … Diejenigen in hochrangigen Positionen oder mit relevantem Eigentum an den »Produktionsmitteln« sind sehr wenige im Vergleich zum Rest der Bevölkerung – zu jenen, die arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Aufgrund ihrer Position im Produktionsprozess haben Kapitalist:innen die Macht, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Etwa wie viele Autos produziert werden, wie viel Öl gefördert wird, oder wie viele Tiere gefüttert werden, um sie zu schlachten. Das objektive Interesse von Kapitalist:innen ist es, höhere Profite zu erzielen, um diese in billigere Produktionsformen zu investieren. So bleiben sie wettbewerbsfähig und werden nicht vom Markt verdrängt. Menschen mit einem eigenen kleinen Geschäft werden oft auch als Zwischenklasse aufgeführt, die von großen Konzernen bedroht ist und gleichzeitig selbst Angestellte hat. Auf diese wird hier nicht weiter eingegangen.
Kapitalist:innen erzielen Profite, indem sie …
- »billige« Ressourcen nutzen: genaugenommen die Ressourcen anderer Länder stehlen, z. B. Holz von indigenem Land.
- Kosten externalisieren bzw. nach außen verlagern: dort produzieren, wo Konzerne nicht für Umweltverschmutzung belangt werden, Müll dort hinbringen oder verbrennen.
- Löhne kürzen und Beschäftigte zwingen, länger zu arbeiten oder weniger Leistungen zu erhalten; Beschäftigte werden nie für die vollen 8(+) Stunden ihrer Tagesarbeitszeit bezahlt, sondern immer nur für einen Teil davon. Der Mehrwert, den sie produzieren, geht an die Kapitalist:innen, die das Extrakapital für Reinvestitionen oder für weitere Profitgenerierung nutzen.
Kapitalist:innen bestimmen größtenteils die Bedingungen, unter denen Beschäftigte arbeiten und wie der Planet behandelt wird. In der europäischen Industrialisierung während des 19. Jahrhunderts – vor der Erkämpfung relevanter Sozialgesetze – führte dies zur Massenarmut, Epidemien, Hunger und Tod. Die kapitalistischen Mechanismen führten zu 500 Jahren kolonialer Unterdrückung und dem Raub von Ressourcen.
In den letzten Jahrzehnten führte diese Klassenstruktur zu gravierenden Umweltzerstörungen und einer kaum noch zu bremsenden Erhitzung des Planeten. An der Klimakrise ist nicht die ist nicht die Menschheit schuld, sie ist das Ergebnis des Kapitalismus und seiner dominierenden Klasse.
Wie in diesem Kapitel beschrieben, gibt es keinen Kapitalismus ohne die Ausbeutung der Natur und der Menschen. Diese Ausbeutung ist jedoch keine Frage von Moral (oder Gier, schlechtem Charakter …), sondern innewohnender Teil des Systems, das ohne die Ausbeutung nicht funktionieren würde.
Nun gibt es aber auch noch einen Staat und nicht nur die beschriebenen Klassen.
- * Eine hier am Nachmittag des 17.7. eingebundene pdf-Datei mit dem Titel „Kapitalismus und Klassen“ und einigen Illustrationen beruhte leider auf einem Mißverständnis zwischen dem Verlag und der Redaktion
Siehe zum Hintergrund:
- v.a. unser Dossier: Klima-Klassenkampf: Internationale Debatten für eine gemeinsame Front gegen Umweltzerstörung und Angriffe auf Arbeits- und Menschenrechte
- Und zur Autorin das Dossier: Wieder ein faktisches Berufsverbot in Bayern: Kultusministerium verweigert der Klimaaktivistin Lisa Poettinger das Referendariat


