- Alltagswiderstand und Commons
- Bündnis Umfairteilen und Aktionen
- Die Occupy-Bewegung und Aktionstage
- Gewerkschaftliche Mobilisierung in der Krise
- Interventionen gegen die neoliberale EU
- Klimastreiks und -kämpfe
- Mobilisierungsdebatte: Wie kämpfen (gegen Kapitalismus)?
- Proteste gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21
Politik in den Zeiten der Deglobalisierung
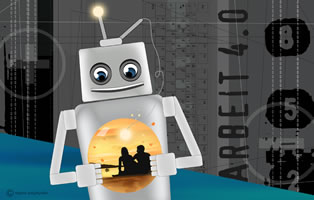 „Während vordergründig über Protektionismus und Freihandel gestritten wird, steuert die Weltwirtschaft auf einen tiefgreifenden Wandel zu. Die Ära der Globalisierung geht zuende. Liegt darin eine Chance? (…) Solange der globale Handel schneller wächst als die Produktion, gilt der Fortschritt der Globalisierung als gesichert. Nun hat sich dieser jahrzehntelange Trend in sein Gegenteil verkehrt. (…) Natürlich werden Produkte wie Bananen, Kaffee und Kakao auch in Zukunft auf den Weltmärkten gehandelt werden, ebenso wie Rohstoffe, Autos oder komplexe Investitionsgüter. Doch der globale Handel wird nicht nur im Zuge der Defragmentierung der Produktion zurückgehen, sondern auch durch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen…“ Beitrag von Gabriela Simon vom 28. April 2017 bei Telepolis
„Während vordergründig über Protektionismus und Freihandel gestritten wird, steuert die Weltwirtschaft auf einen tiefgreifenden Wandel zu. Die Ära der Globalisierung geht zuende. Liegt darin eine Chance? (…) Solange der globale Handel schneller wächst als die Produktion, gilt der Fortschritt der Globalisierung als gesichert. Nun hat sich dieser jahrzehntelange Trend in sein Gegenteil verkehrt. (…) Natürlich werden Produkte wie Bananen, Kaffee und Kakao auch in Zukunft auf den Weltmärkten gehandelt werden, ebenso wie Rohstoffe, Autos oder komplexe Investitionsgüter. Doch der globale Handel wird nicht nur im Zuge der Defragmentierung der Produktion zurückgehen, sondern auch durch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen…“ Beitrag von Gabriela Simon vom 28. April 2017 bei Telepolis ![]() und mehr daraus/dazu:
und mehr daraus/dazu:
- Interview mit dem philippinischen Globalisierungskritiker und Soziologen Walden Bello: Welche Deglobalisierung?

Ein Gespräch von Christa Wichterich vom 28. August 2025 in Neues Deutschland online mit Walden Bello über das Erbe der Bewegung und deren scheitern – sowie die neue Weltordnung: „Als ich vom Scheitern sprach, bezog ich mich hauptsächlich auf die revolutionäre Bewegung auf den Philippinen. Und auch auf das größere sozialistische Projekt der vergangenen 150 Jahre, das, ob wir es nun gut finden oder nicht, durch den Zusammenbruch der Regierungen in Osteuropa und in der Sowjetunion Auswirkungen auf das gesamte sozialistische, ja sogar auf das sozialdemokratische Projekt hatte. Aber als ich zu schreiben begann, wurde mir klar, dass wir in jüngerer Zeit doch etwas erreicht haben. Zum einen haben wir die Globalisierungsstrategien diskreditiert. Wir haben gezeigt, dass der Neoliberalismus ein falsches Projekt ist, wenn es darum geht, mehr Wohlstand für die Menschen und den Planeten zu schaffen. Aber wir haben auch die Vereinigten Staaten im Nahen Osten gestoppt, nach 20 Jahren Intervention. Wir haben eine Antikriegsbewegung aufgebaut. Die »New York Times« bezeichnete sie als »zweite Weltmacht« nach den Vereinigten Staaten, als wir gegen den Krieg im Irak vorgingen. Das ist die erste Klarstellung, die ich machen möchte. Die zweite ist, dass es ein unvollständiger Sieg war, weil wir nicht in der Lage waren, an diese Bewegung gegen den Neoliberalismus eine Bewegung anzuknüpfen, die tatsächlich neue Strukturen als Alternative zu dem geschaffen hätte, was der Neoliberalismus hervorbrachte. Außerdem ist es der Antikriegsbewegung nicht gelungen, sich zu institutionalisieren. Es waren also unvollständige Siege. Aber warum? Ich versuche immer noch zu verstehen, warum wir keine Bewegungen schaffen können, die sich selbst verstetigen und dauerhafte Institutionen schaffen. Das versuche ich zu erforschen. Es ist schwierig, eine Alternative zu formulieren. Wie institutionalisiert man eine Organisation, die diese Alternative am Leben erhält? Damit ringe ich. (…) Zunächst einmal denke ich, dass wir zwar in einem globalen kapitalistischen System leben, aber die Welt tatsächlich in Staaten als Wirtschaftsakteure aufgeteilt ist, die in der Weltwirtschaft miteinander konkurrieren. Wir sehen, dass die alten Regeln in Bezug auf den freien Handel und all das nicht mehr gelten und wir nun in eine Phase geoökonomischer Institutionen eintreten, in der der Staat eine wichtige Rolle spielt. In diesem Sinne findet eine Deglobalisierung statt, das ist eine Tatsache. Aber diese Deglobalisierung ist nicht genau das, was ich zuvor im Sinn hatte. Die Deglobalisierung, für die ich mich einsetzte, war eher eine ethische, wirtschaftliche Perspektive, in der das Subsidiaritätsprinzip und die Demokratie weltweit stärker zum Tragen kommen würden, in der wir eine Wirtschaftspolitik hätten, die in erster Linie lokal verankert wäre, sich aber nicht von der Welt abschotten würde. Sie wäre regional und auch global integriert, aber mit einem hohen Maß an nationaler Autonomie. Das war die Perspektive, die wir vertreten haben und die stark von den Kräften beeinflusst war, die in den vergangenen 25 Jahren auf lokaler und regionaler Ebene auf Autonomie gedrängt haben. Das ist die wirtschaftliche Ebene. Auf politischer und militärischer Ebene findet ebenfalls eine Deglobalisierung statt, die sich in der Entstehung von Einflussbereichen äußert. Die Vereinigten Staaten ziehen sich aus ihrer Rolle als globale Hegemonialmacht zurück und entwickeln sich zu einer regionalen Hegemonialmacht, die eine Festung Amerika errichtet, ähnlich wie Europa eine Festung Europa errichtet und Russland den größten Einfluss auf Osteuropa und China auf den asiatisch-pazifischen Raum ausübt. Es gibt also eine Art geopolitischen und geoökonomischen Wettbewerb, der die globalisierte Welt der westlich dominierten Institutionen, multilateralen Regeln und des freien Handels ersetzt. Das ist meine Einschätzung der aktuellen Lage. (…) Wir müssen sehr sensibel damit umgehen, dass viele Menschen an der Migration partizipieren wollen.“
über das Erbe der Bewegung und deren scheitern – sowie die neue Weltordnung: „Als ich vom Scheitern sprach, bezog ich mich hauptsächlich auf die revolutionäre Bewegung auf den Philippinen. Und auch auf das größere sozialistische Projekt der vergangenen 150 Jahre, das, ob wir es nun gut finden oder nicht, durch den Zusammenbruch der Regierungen in Osteuropa und in der Sowjetunion Auswirkungen auf das gesamte sozialistische, ja sogar auf das sozialdemokratische Projekt hatte. Aber als ich zu schreiben begann, wurde mir klar, dass wir in jüngerer Zeit doch etwas erreicht haben. Zum einen haben wir die Globalisierungsstrategien diskreditiert. Wir haben gezeigt, dass der Neoliberalismus ein falsches Projekt ist, wenn es darum geht, mehr Wohlstand für die Menschen und den Planeten zu schaffen. Aber wir haben auch die Vereinigten Staaten im Nahen Osten gestoppt, nach 20 Jahren Intervention. Wir haben eine Antikriegsbewegung aufgebaut. Die »New York Times« bezeichnete sie als »zweite Weltmacht« nach den Vereinigten Staaten, als wir gegen den Krieg im Irak vorgingen. Das ist die erste Klarstellung, die ich machen möchte. Die zweite ist, dass es ein unvollständiger Sieg war, weil wir nicht in der Lage waren, an diese Bewegung gegen den Neoliberalismus eine Bewegung anzuknüpfen, die tatsächlich neue Strukturen als Alternative zu dem geschaffen hätte, was der Neoliberalismus hervorbrachte. Außerdem ist es der Antikriegsbewegung nicht gelungen, sich zu institutionalisieren. Es waren also unvollständige Siege. Aber warum? Ich versuche immer noch zu verstehen, warum wir keine Bewegungen schaffen können, die sich selbst verstetigen und dauerhafte Institutionen schaffen. Das versuche ich zu erforschen. Es ist schwierig, eine Alternative zu formulieren. Wie institutionalisiert man eine Organisation, die diese Alternative am Leben erhält? Damit ringe ich. (…) Zunächst einmal denke ich, dass wir zwar in einem globalen kapitalistischen System leben, aber die Welt tatsächlich in Staaten als Wirtschaftsakteure aufgeteilt ist, die in der Weltwirtschaft miteinander konkurrieren. Wir sehen, dass die alten Regeln in Bezug auf den freien Handel und all das nicht mehr gelten und wir nun in eine Phase geoökonomischer Institutionen eintreten, in der der Staat eine wichtige Rolle spielt. In diesem Sinne findet eine Deglobalisierung statt, das ist eine Tatsache. Aber diese Deglobalisierung ist nicht genau das, was ich zuvor im Sinn hatte. Die Deglobalisierung, für die ich mich einsetzte, war eher eine ethische, wirtschaftliche Perspektive, in der das Subsidiaritätsprinzip und die Demokratie weltweit stärker zum Tragen kommen würden, in der wir eine Wirtschaftspolitik hätten, die in erster Linie lokal verankert wäre, sich aber nicht von der Welt abschotten würde. Sie wäre regional und auch global integriert, aber mit einem hohen Maß an nationaler Autonomie. Das war die Perspektive, die wir vertreten haben und die stark von den Kräften beeinflusst war, die in den vergangenen 25 Jahren auf lokaler und regionaler Ebene auf Autonomie gedrängt haben. Das ist die wirtschaftliche Ebene. Auf politischer und militärischer Ebene findet ebenfalls eine Deglobalisierung statt, die sich in der Entstehung von Einflussbereichen äußert. Die Vereinigten Staaten ziehen sich aus ihrer Rolle als globale Hegemonialmacht zurück und entwickeln sich zu einer regionalen Hegemonialmacht, die eine Festung Amerika errichtet, ähnlich wie Europa eine Festung Europa errichtet und Russland den größten Einfluss auf Osteuropa und China auf den asiatisch-pazifischen Raum ausübt. Es gibt also eine Art geopolitischen und geoökonomischen Wettbewerb, der die globalisierte Welt der westlich dominierten Institutionen, multilateralen Regeln und des freien Handels ersetzt. Das ist meine Einschätzung der aktuellen Lage. (…) Wir müssen sehr sensibel damit umgehen, dass viele Menschen an der Migration partizipieren wollen.“ - Weiter aus dem Beitrag von Gabriela Simon vom 28. April 2017 bei Telepolis
 :“… Die Deglobalisierung führt in Ländern des globalen Südens zu einem Verlust von Industrien. Wenn beispielsweise mehr und mehr Textilkonzerne ihre Produktionen dorthin zurückholen, wo die Kundschaft ist, dann werden die Initiativen, die sich heute für die Rechte der asiatischen Textilarbeiterinnen einsetzen, bald ins Leere laufen. (…) Die neuen Technologien, die diesen Wandel herbeiführen, sind noch mitten im Entwicklungsprozess. Aber wenn es in ein paar Jahren möglich ist, nicht nur Sportschuhe, sondern auch komplexere technische Produkte wie Herzschrittmacher oder Turbinenschaufeln mit einem 3D-Drucker herzustellen, dezentral und dem konkreten Bedarf angepasst – wozu braucht man dann noch einen global aufgestellten Konzern? All das kann dann im Prinzip auch von einem Kollektiv, einer kleinen Genossenschaft oder einem kommunalen Verein produziert werden – in Franken, Andalusien, Sri Lanka oder Senegal. So könnten die neuen Technologien zur Grundlage eines anderen Entwicklungsmodells in Nord und Süd werden. Oder, klassisch marxistisch formuliert: die neuen Produktivkräfte setzen neue Produktionsverhältnisse auf die Tagesordnung. Auch die Perspektiven internationaler Solidarität und globaler Gerechtigkeit würden sich damit grundlegend verändern. Die Frage ist dann „nur“ noch, mit welchen Strategien sich die Gesellschaften die neuen Technologien und all die anderen nötigen Ressourcen aneignen können.“
:“… Die Deglobalisierung führt in Ländern des globalen Südens zu einem Verlust von Industrien. Wenn beispielsweise mehr und mehr Textilkonzerne ihre Produktionen dorthin zurückholen, wo die Kundschaft ist, dann werden die Initiativen, die sich heute für die Rechte der asiatischen Textilarbeiterinnen einsetzen, bald ins Leere laufen. (…) Die neuen Technologien, die diesen Wandel herbeiführen, sind noch mitten im Entwicklungsprozess. Aber wenn es in ein paar Jahren möglich ist, nicht nur Sportschuhe, sondern auch komplexere technische Produkte wie Herzschrittmacher oder Turbinenschaufeln mit einem 3D-Drucker herzustellen, dezentral und dem konkreten Bedarf angepasst – wozu braucht man dann noch einen global aufgestellten Konzern? All das kann dann im Prinzip auch von einem Kollektiv, einer kleinen Genossenschaft oder einem kommunalen Verein produziert werden – in Franken, Andalusien, Sri Lanka oder Senegal. So könnten die neuen Technologien zur Grundlage eines anderen Entwicklungsmodells in Nord und Süd werden. Oder, klassisch marxistisch formuliert: die neuen Produktivkräfte setzen neue Produktionsverhältnisse auf die Tagesordnung. Auch die Perspektiven internationaler Solidarität und globaler Gerechtigkeit würden sich damit grundlegend verändern. Die Frage ist dann „nur“ noch, mit welchen Strategien sich die Gesellschaften die neuen Technologien und all die anderen nötigen Ressourcen aneignen können.“


