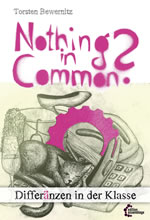
„…
Eine ganz entscheidende Weiterentwicklung dieser Position, die Feminismus und Klassenkampf zusammendenkt, ist aus der italienischen Gruppe „Lotta Feminista“ hervorgegangen. 1973 erschien Mariarosa Dalla Costas „Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft“ auf deutsch im Merve-Verlag. Mariarosa Dalla Costa und Silvia Federici waren aktiv in der Kampagne für einen Lohn für Hausarbeit, in dem es nicht so sehr um den Lohn ging, sondern letztlich darum, die Hausarbeit als reproduktive Arbeit zu dekonstruieren und von der männlich konnotierten Lohnarbeit ununterscheidbar zu machen. Wenn wir uns also fragen „Wat is eene Hex‘?“, ist die Antwort schlicht: die aktive Frau in der Öffentlichkeit. (…) Die Geschichte hat die Anführerinnen unsichtbar gemacht, aber in den ketzerischen Bewegungen waren Frauen Anführerinnen, bei den Kämpfen gegen die Einhegung der Allmende in England gab es zahlreiche weibliche Captains. „Passiv“ wurden Frauen immer erst, wenn sie mit Gewalt dazu gezwungen wurden. In der offiziellen Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung tauchen kaum Frauen auf – wie auch, wenn sich diese Geschichtsschreibung auf die Industriefabriken konzentriert, aus denen Frauen meist und mehrheitlich ausgeschlossen wurden? Die Ausnahme des Crimmitschauer Textilarbeiter*innenstreiks wurde zwar aufgenommen, aber der erfolgreiche wilde Streik für einen gleichen Lohn von 1.600 migrantischen Arbeiterinnen (bei insgesamt 2000 Streikenden) 1973 bei Pierburg/Neuss fehlt meist immer noch (…) Wenn der Klassenkampf wahrgenommen wird als Kampf männlicher Arbeiter in Fabriken, sind Frauen selbstverständlich unsichtbar. Folglich ist dies eine völlig verkehrte Wahrnehmung des Konflikts von Kapital und Arbeit. Denn wie wir gesehen haben, ist die Konstruktion der Frau ein Fundament des Kapitalismus. Und eingedenk der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation, die immer auch eine Akkumulation des – vor allem weiblichen – Körpers ist und deren Gewaltförmigkeit in Krisensituationen wie der aktuellen eskaliert, wird deutlich, dass die Geschlechterdifferenz in der Krise besonders bedeutsam wird…“ Aus dem
Kapitel „Kriege, Krisen, Klassenkampf – Fragen des Feminismus“ des Buchs „Nothing in common? Differänzen in der Klasse“ von Torsten Bewernitz. Das Buch ist bereits im Dezember 2015 bei Edition Assemblage erschienen (978-3-942885-84-3 | 973), siehe weitere Informationen beim Verlag, dem wir für die Freigabe des Kapitels danken!
weiterlesen »